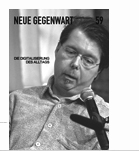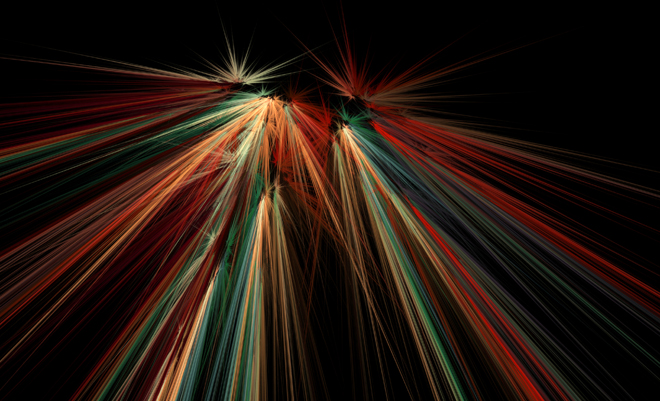|
Bleibt
alles anders?
Die Digitalisierung der Wissenschaft
Text:
André Donk
Bild:
Patrick Hajzler |

Das WDR3-Radiofeature „Rundum digital. Wie sich die
Wissenschaft in der digitalen Welt eingerichtet hat“ ist sicher: Am Internet
als neuem Medium des Wissens und der Wissenschaft führt allein schon wegen
seiner enormen Kapazität und Geschwindigkeit von Informationsspeicherung und
-distribution kein Weg mehr vorbei. Und eine Gesellschaft, die ihr Wachstum
in zunehmendem Maße auf wissenschaftlichen Fortschritt als Produktivkraft
baut, kann es sich nicht leisten auf die Gewinne der Digitalisierung der
Wissenschaft zu verzichten. Doch wie genau wirkt sich die Digitalisierung
auf das Wissenschaftssystem aus – was sind die Kehrseiten dieser
Entwicklung?
Spätestens seit Daniel Bells Studie zur postindustriellen Ökonomie (1975)
wird die Bedeutung von Wissen und Wissenschaft in den westlichen
Gesellschaften diskutiert. Bell nimmt an, dass die Ära der industriellen
Produktion sich ihrem Ende entgegenneigt und dies zu massiven Verlagerungen
von industrie- zu wissensbasierten Arbeitsplätzen führt. Wissenschaftliches
Wissen ist damit zu einer zentralen Produktivkraft und wichtigen
ökonomischen Ressource avanciert (Knorr-Cetina 2007: 328). Auch andere
gesellschaftliche Funktionsbereiche wie die Politik sind für verlässliche
Entscheidungen verstärkt auf wissenschaftliche Beratung und Modelle,
Prognosen und Theorien angewiesen (Maasen/Winterhager 2001). Dabei darf die
Bedeutung neuer Kommunikations- und Medientechnologien nicht unterschätzt
werden: So sind viele mathematisch-physikalische Beweise und Großexperimente
nur durch enorm gesteigerte Rechnerkapazitäten denkbar, haben gerade
medizinische Forschung, Diagnose und Therapie von Computertechnik und
bildgebenden Verfahren profitiert und sind schließlich auch
sozialwissenschaftliche Modelle und präzise Auswertungen großer Datenmengen
ohne Rechner kaum möglich – ganz zu schweigen von der beschleunigten
Recherche und Publikation wissenschaftlicher Erkenntnis (Drenth 2001;
Knorr-Cetina 2000; Krull 2001).
Nicht erst durch die ausführliche feuilletonistische Erörterung der
psychischen und sozialen Folgen auf Hochgeschwindigkeit beschleunigter
Individuen wissen wir, dass das Mehr an kommunizier- und konsumierbarem
Wissen auch eine enorme Belastung bedeuten kann. Wer fühlt sich gewappnet,
die Trefferzahl immer umfassender und zielgenauerer Suchmaschinen noch zu
verarbeiten? Wer das Meer der Online-Publikationen zu überblicken? Und wer
der permanenten Erreichbarkeit durch Fachkollegen oder Studenten per E-Mail
zu bestehen? Denn wir erleben die Beschleunigung von Information und
Kommunikation nicht allein als Rationalitätsgewinn. Aus unserer
Alltagserfahrung wissen wir, dass neue, angeblich zeitsparende Technologien
oftmals bei der Bedienung, Wartung und bei Störungen noch zusätzliche Zeit
kosten. Der Soziologe Hartmut Rosa hat jüngst darauf hingewiesen: Es ist
paradox, je mehr Zeit wir zum Beispiel durch die schnelle Online-Suche von
Texten sparen, desto weniger haben wir. Beschleunigung führt daher mit Rosa
nicht nur zur Schaffung „neuer Handlungsfelder und -möglichkeiten“ (2005: 123),
sondern als Nebeneffekt zur Vernichtung von Zeit, da für „deren Nutzung dann
zusätzliche Zeitressourcen benötigt werden“ (ebd.).
Sollten wir daher nicht eine verstärkte Skepsis ob der Störanfälligkeit und
Fragilität der neuen Technologien walten lassen? Ein hoher Stellenwert von
Wissen in einer und für eine Gesellschaft deutet auf ein hohes Maß
funktionaler Differenzierung und ein damit verbundenes hohes Maß an
gesellschaftlicher Komplexitität hin. Und je höher die gesellschaftliche
Komplexität ist, desto störanfälliger ist auch dieses Gefüge (Stehr 2001).
So kann auch die Beschleunigung der Wissensproduktion und -distribution
ambivalente Effekte zeitigen: Die Halbwertzeit des Wissens wird immer
geringer, Wissensbestände immer unübersichtlicher. Es wird immer mehr, immer
neues Wissen produziert, das immer schneller veraltet und damit ersetzt
werden muss, so dass wieder neues Wissen entsteht. Der
Kommunikationswissenschaftler Richard Münch (1991) bezeichnet dieses
Phänomen in seinem Werk Dialektik der Kommunikationsgesellschaft als
Paradoxie des Rationalismus.
Bislang indes gibt wenig empirische Befunde, die uns Aufschluss über die
tatsächlichen positiven wie negativen Auswirkungen neuen Kommunikations- und
Medientechnologien innerhalb der Wissenschaft und deren Folge für die
Gesellschaft als Ganzes geben könnten. Einzelne Befunde zeigen zum Beispiel, dass
Internetplagiarismus unter englischen Studenten durchaus verbreitet ist:
Etwa ein Drittel von ihnen hat schon einmal mittels Copy-and-Paste Informationen aus
dem Internet in eigene Arbeiten importiert (Underwood/Szabo 2004). Oder dass
französische Wissenschaftler eine von vier Arbeitsstunden mit dem Lesen und
Beantworten von E-Mails verbringen (Lahlou 2008). Ein umfassendes Bild jedoch
steht bis dato aus – integrierende theoretische Perspektiven wie empirische
Daten fehlen, auch wenn in Deutschland erste Projekte wie der
Forscherverbund „Interactive Science“ daran arbeiten. Die Herausforderung in
der Theoriebildung wie der empirischen Untersuchung des Einflusses neuer
Kommunikations- und Medientechnologien besteht daher in der Berücksichtigung
die technologischen Materialität im Kontext ihrer Nutzung (Barett/Grant/Wailes
2006). Das heißt konkret, dass sowohl die Mediennutzung und die Mediennutzer
von neuen Kommunikations- und Medientechnologien in den Blick zu kriegen als
auch Technik als Ergebnis menschlichen Handelns zu denken sind. Neue
Technologien sind in dieser Perspektive dann auch eine Antwort auf die
gesteigerte soziale Komplexität moderner Gesellschaften (Degele 2000; Yzer/Southwell
2008). Erste Ergebnisse eigener Studien zeigen, dass je nach Disziplin und
je nach Forschungsgebiet mit einer unterschiedlichen Durchdringung und eben
auch unterschiedlichen Nutzen wie Kosten zu rechnen ist. Wie also die
Digitalisierung das Wissenschaftssystem tatsächlich verändert, kann zur Zeit
noch nicht seriös beantwortet werden?
Eines jedoch ist sicher: Die
Durchdringung der Wissenschaft mit digitalen Kommunikationstechnologien hat
das Potenzial zu tiefgreifenden Veränderungen – zum guten wie zum
schlechten. Es besteht also noch kein Anlass zu Technoeuphorie noch zu
Schwarzmalerei, auf die tatsächliche Nutzung und die wahrgenommenen Effekte
kommt es an.

Literatur
Barrett, Michael; Grant, David; Wailes, Nick (2006): ICT and Organizational
Change. In: Journal of Applied Behavioral Science, 42. Jg., S. 6-22.
Bell, Daniel (1975): Die nachtindustrielle Gesellschaft. Frankfurt a. M.
Degele, Nina (2000): Informiertes Wissen. Eine Wissenssoziologie der
computerisierten Gesellschaft. Frankfurt a. M.
Drenth, Pieter J.D. (2001): Die digitale Revolution in den Wissenschaften:
ein "mixed blessing". Festvortrag an der Universität Heidelberg, gehalten am
08.12.2001.
 Online-Dokument. Online-Dokument.
Knorr-Cetina, Karin (2000): Die Wissensgesellschaft. In: Pongs, Armin
(Hrsg.): In welcher Gesellschaft leben wir eigentlich? Gesellschaftskonzepte
im Vergleich, Band 2. München, S. 150-169.
Knorr-Cetina, Karin (2007): Neue Ansätze der Wissenschafts- und Techniksoziologie. In:
Schützeichel, Rainer (Hrsg.): Handbuch Wissenssoziologie und
Wissensforschung. Konstanz, S. 328-342.
Krull, Wilhelm (2001): German universities on the threshold of the
twenty-first century. In: Maasen, Sabine/ Winterhager, Matthias (Hrsg.):
Science Studies. Probing the dynamics of scientific knowledge. Bielefeld, S.
125-143.
Lahlou, Saadi (2008): Cognitive technologies, social science and the
three-layered leopardskin of change. In: Social Science Information, 47.
Jg., S. 227-251.
Münch, Richard (1991): Dialektik der Kommunikationsgesellschaft. Frankfurt
a.M..
Rosa, Hartmut (2005): Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in
der Moderne. Frankfurt a.M..
Stehr, Nico (2001) Moderne Wissensgesellschaften. In: Aus Politik und
Zeitgeschichte B36/2001, S. 7-14.
Szabo, Attila; Underwood, Jean (2004): Cybercheats. Is Information and
Communication Technology fuelling academic dishonesty? In: Active Learner in
Higher Education, 5. Jg., S. 180-199.
Yzer, Marco C.; Southwall, Brian J. (2008): New Communication Technologies,
Old Questions. In: American Behavioral Scientist, 52. Jg., 8-20. |