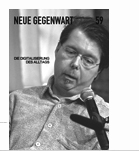|
Google Streetview
–
Über ein Bildlexikon und seinen Alleingeltungs-anspruch
Text:
Simon Bieling
Bild:
Google Streetview
|

1927 beschrieb der Künstler László Moholy-Nagy hoffnungsvoll
eine Zukunft, in der jeder eine private Pinakothek von Reproduktionen sein
eigen nennen können würde. Mit der „Haus-Pinakothek“ sollte die
„Vorherrschaft des manuell hergestellten Einzelbildes“ einem endgültigen
Ende zugeführt werden. Der „tote Zimmerschmuck“ des singulären Wandbildes
sollte mit einer Vielzahl von in Schrankfächern abgelegten Reproduktionen
ersetzt werden. Die einfache Verfügbarkeit einer großen Zahl von Bildern
hielt er für eine willkommene Zukunftsvision.
Klobige Bildschränke, wie sie sich Moholy-Nagy wünschte, haben trotz des
Werbetalents des Künstlers nie in den Wohnzimmern Einzug erhalten. Nur seine
Hoffnung, dass der Vielzahl der Bilder vor dem Einzelbild der Vorzug zu
geben und die Verfügbarkeit der Bilder zu erhöhen sei, wurde mit Websites
wie YouTube, Flickr, aber auch Google Maps mehr als erfüllt. Dennoch wäre es
unpassend gar in den Bildwelten des Internets eine „Haus-Pinakothek“ neueren
Datums oder eines universalen musée imaginaire zu sehen. Denn damit näherte
man sich nicht nur den reichlich abgegriffenen Metaphern des Internets als
eines „virtuellen Raums“ an. Auch würde ein einfaches, aber wesentliches
Faktum zu wenig hervorgehoben. Trotz aller Unterschiede ist es den
Bildportalen nämlich gemein, dass sie erlauben, Bilder nach Begriffen
abzurufen.
So erfasst es die Merkmale der Bildportale besser, wenn man sie als
Bild-Enzyklopädien beschreibt. Websites wie YouTube, Flickr werden
schließlich für nichts anderes genutzt als Bilder nachzuschlagen. Sie sind
darüber hinaus aber auch deshalb Enzyklopädien, weil die Seiten für nahezu
jedes Bildinteresse, das mit einem Begriff eingegeben werden kann, Bilder
zur Anzeige bringen können. Die verschiedenen Bildplattformen machen für
jeden Begriff, der einen Ort, eine Person, eine Region, ein Restaurant oder
ein Produkt bezeichnet, Bilder verfügbar. Vielbändige Buchenzyklopädien
entsprechen der Erwartung, gestützt auf Autoritäten einen umfassenden
Überblick des existierenden Wissens zu bieten. Von den heute zugänglichen
Bildportalen, den Bildlexika des Internets, erhoffen wir uns dagegen zu
allen denkbaren Begriffen eine möglichst hohe Bildausbeute.
Enzyklopädien sind gekennzeichnet durch zwei entgegenläufige Merkmale, die
sie jeweils stärker oder schwächer prägen. Einige sind im Arrangement ihrer
Inhalte stark als eine umfassende Systematik angelegt. Überwiegt dieser
Aspekt versuchen sie für sich einen Autoritätsstatus zu etablieren, indem
sie sich als beglaubigende Wissensinstanz in Szene setzen. Andere
Enzyklopädien haben hingegen eher die Eigenschaft, einzelne Wissensgebiete
so in Nachbarschaft zu stellen, dass durch Vergleichsmöglichkeiten
einseitige Privilegien bestimmter Gebiete relativiert werden können.
Ähnliches gilt auch für hier als Bildlexika- oder -enzyklopädien
bezeichneten Bildportale des Internets. Ein Teil von ihnen, besonders aber
Google Streetview und Google Maps, organisieren ihre Bildangebote in eine
einheitliche Systematik. Andere Formate wie YouTube und Flickr betten
dagegen die Bilder eher in vielfache Vergleichshorizonte ein.
Hinsichtlich der jüngsten Entwicklungen eines ‚mobilen Internets‘ ist vor
allem Google Streetview
unter den relevanten visuellen Bildenzyklopädien
von besonderem Interesse. Für diese Unterfunktion von Google Maps ist die
mobile Verfügbarkeit als Bildenzyklopädie mit besonderen Konsequenzen
verbunden. Die Funktion ist letztlich als das Versprechen ausgerichtet, zu
jedem Ort, ob Stadt oder Land, ein Bild liefern zu können. Da auf diese per
Smartphone oder Mobiltelefon heute bequem an letztlich jedem Ort zugegriffen
werden kann, werden Bilder öfter als zuvor in einen unmittelbaren Bezug mit
den Gegenständen gesetzt, die sie selbst abbilden. Google Streetview
liefert in diesen Fällen nicht nur Abbildungen. Das aufgerufene Bild erzeugt
dann auch Erwartungen, mit denen die abgebildeten Gegenstände und Orte in
Bezug gesetzt werden.
Schon heute liegt es schließlich nahe, in bereits ‚erfassten‘ Städten wie
London oder New York, etwa jedem Besuch eines Restaurants auf dem Weg noch
einen kurzen, prüfenden Blick auf dessen Bildauftritt in Google Streetview
vorausgehen zu lassen. Der Abbildung der Fassadenflächen sowie der Straßen
und Plätzen, an denen sich ein Restaurant befindet, möchte man entnehmen,
wie gut etwa die Atmosphäre des Restaurants oder gar das Essen sein könnte.
Ist das Ergebnis der Bildlektüre ansprechend genug, hofft man, dass es den
eigenen Erwartungen auch insgesamt entsprechen wird. So entscheidet eine
Vorbesichtigung per Bild über den letztendlichen Besuch.
Die Pointe liegt aber freilich nicht nur darin. Ein Restaurant kann gleich
doppelte Bildtauglichkeit und Fotogenität beweisen, wenn
Google Streetview
zum alltäglichen Bildnachschlagewerk wird: zum einen in der Übersetzung zum
Bild, das auf dem Mobiltelefon innerhalb von Google Streetview einer
eingehenden Prüfung unterzogen wird und zum anderen aber auch vor Ort, wo
den möglicherweise positiven Qualitäten des Bildes auch entsprochen werden
muss. Ein prägnanter Schriftzug oder eine besondere Farbgestaltung der
Fassade können eingesetzt werden, um dem Bild gerecht zu werden.
Die Eindrücke, die dem aufgerufenen, nachgeschlagenen Bild entnommen worden
sind, bilden einen Erwartungshorizont, der im besten Fall nicht zu
enttäuschen ist. Wie stark sich diese Entwicklung erweisen wird, hängt davon
ab, ob es tatsächlich zu einer Gewohnheit wird, die Bildansichten der Stadt
eines Angebots wie
Google Streetview bei solchen Gelegenheiten einzusetzen.
Für andere schon immer auf Schaubarkeit und Bildtauglichkeit angelegte
Viertel und Gebäude des urbanen Raums, also etwa Sehenswürdigkeiten,
entsteht dadurch dagegen keine entscheidende Novität. Weil zum Beispiel die
beiden bekannten Türme von Pisa und Paris schon lange als willkommene
Bildgegenstände etabliert sind, findet hier keine wesentliche Änderung
statt. Man versichert sich allenfalls noch einmal ihrer Bildwürdigkeit, wenn
man ihre Bild kurz vor Ankunft noch einmal auf dem Mobiltelefon in
Google Streetview
nachschlägt. Dass sie dort stärker als bisher innerhalb eines
größeren Bildzusammenhangs erscheinen, ist so die vielleicht einzige
Änderung, die für die zukünftigen Bildkarrieren solcher Sehenswürdigkeiten
zu erwarten ist.
Bisher als kaum interessant bewertete Orte in der Umgebung
erhalten als Bildnachbarn Relevanz. Der weitverbreitete Wunsch, die nur zur
Ansicht bestimmten Sehenswürdigkeiten aufzusuchen, um Selbstporträttrophäen
nach Hause zu bringen, wird jedoch vermutlich bestehen bleiben.
Google Streetview transformiert den städtischen Raum in ein umfassendes
lesbares visuelles Feld. Die Bilder urbaner Räume werden eingefügt in ein
scheinbar unbegrenztes Panorama, das je nur in Ausschnitten sich dem
Besucher offeriert. Damit liefert
Google Streetview als Bildenzyklopädie
neue Möglichkeiten, städtische und ländliche Räume zu lesen und zu deuten.
Jeden Ort auf dem Mobiltelefon zunächst einer Vorbesichtigung unterziehen zu
können, verschafft die Möglichkeit, dem städtischen Raum auf neue Art und
Weise Bedeutungen zuzuordnen. Nichtsdestotrotz ist auch eine Distanznahme zu
Google Streetview nicht nur unter datenschutzrechtlichen
Gesichtspunkten angebracht. Denn mit diesem visuellen Lexikon der Orte nimmt
das Unternehmen die zweifelhafte Autorität einer ‚bildgebenden‘ Instanz in
Anspruch. Falsch wäre es, dieser Tendenz stattzugeben, der Fotografie eines
Ortes allein aufgrund seines Erscheinungskontextes in
Google Streetview
Geltung zuzuschreiben und jegliche alternative Bildmöglichkeiten von
vornherein auszuschließen. Zu hoffen bleibt deshalb, dass es gelingt, eine
Bildkonkurrenz diesen Versuchen entgegenzusetzen. Nicht aber, um etwa das
eigentliche Bild der Stadt zu präsentieren. Erstrebenswerter ist es, der
doch einseitigen Bildperspektive der
Google Streetview weitere hinzuzufügen
und so auf vermeintlich nicht existierende Vergleichsbilder hinzuweisen.
Allein damit wäre schon der Zweck erreicht, dass ein städtischer Raum anhand
nicht nur eines, sondern vieler Bilder der Lesbarkeit zugänglich gemacht
würde. |