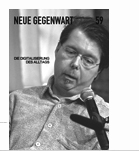|
Noch immer gelten Computerspieler vielen als
nachtaktive, sprachfaule Technikfreaks mit einem, sagen wir, etwas
eigentümlichen Humor und bisweilen besorgniserregenden
Ernährungsgewohnheiten – Nerds eben.
Längst werden jedoch – neben den im medienpolitischen Diskurs oft als
„Killerspiele“ bezeichneten gewalthaltigen Computerspielen – zahlreiche
Online Games für Senioren oder für den Schulunterricht angeboten, und mit
dem rasanten Wachstum sozialer Netzwerke im Internet wächst auch die
Verbreitung und Akzeptanz von Online Social Games in der Gesellschaft. Auf
den ersten, durchaus skeptischen Blick erscheinen die Spiele, von denen „Farmville“
wohl das bekannteste ist, allenfalls als lustiger Zeitvertreib – aufgrund
ihres Suchtpotentials zwar mit Vorsicht zu genießen, aber an sich eine
drollige, harmlose Randerscheinung des „Web 2.0“. Dabei ist das Spiel eine
Jahrtausende alte Kulturtechnik, die aus der Entwicklung der Zivilisationen
wie aus der Sozialisation jedes einzelnen Menschen nicht wegzudenken ist.
Die sich im Internet entfaltende Spielkultur sollte daher nicht nur im
Hinblick auf ihre möglicherweise pathologischen und destruktiven Effekte,
sondern auch im Hinblick auf ihr Potenzial für die Bildung und Erneuerung
gesellschaftlicher Strukturen diskutiert werden.
Die meisten Spieler von Online Social Games bevorzugen – wie bei den
traditionellen „Offline“-Spielen – das gemeinsame Spielen mit Freunden und
Bekannten. Erst wenn sie eine fortgeschrittene Spielstufe erreicht haben,
suchen sie vermehrt den Kontakt zu fremden Mitspielern. Vor allem die so
genannten MMORPGs (Massively Multiplayer Online Role-Playing Games)
verstärken jedoch den Trend zu häufigeren Interaktionen mit Fremden. In
solchen Spielen verbünden sich die Spieler zu Dutzenden in Clans und Gilden,
um gemeinsam Aufgaben zu lösen. Die Bedeutung „echter Freunde“ in Social
Games wird in Zukunft also aller Voraussicht nach abnehmen. Die Spieler
werden sich mehr und mehr auf das Zusammenspiel mit unbekannten Mitspielern
einlassen. Mit der zunehmenden Verbreitung von leistungsfähigen Smartphones
steigt auch die Nutzung von Mobile Social Games, die nicht selten in
sozialen Netzwerken integriert sind. Spielen beschränkt sich nicht länger
auf Mittagspausen im Büro oder auf den fernsehfreien Feierabend am
heimischen Multimedia-PC. In GPS-gestützten Mobile Social Games wird die
reale Umgebung, vor allem die Stadt oder das Stadtviertel, in das
Spielgeschehen integriert. Die virtuellen sozialen Netzwerke legen sich über
die reale Geographie unserer Städte. So wird die Stadt zu einem virtuellen
Spielfeld; die Netzwerke hingegen gewinnen an Raum. Dies hat zur Folge, dass
sich die Nähe zu den Mitspielern nicht mehr nur nach dem Grad der
Bekanntschaft („echte“ Freunde, Bekannte, Kollegen oder eben Unbekannte),
sondern nun auch und zunehmend nach dem Grad der räumlichen Entfernung
bemisst. Einmal mehr verschwimmen die Grenzen zwischen virtuell und real,
zwischen offline und online – und zwischen öffentlich und privat. Als Mobile
Social Games ziehen interaktive Spielformen aus der Privatsphäre wieder in
die Öffentlichkeit ein.
In seinem Anfang der 1970er Jahre erschienenen Werk „Verfall und Ende des
öffentlichen Lebens“ beschreibt der US-amerikanische Soziologe
 Richard
Sennett das Absterben des öffentlichen Raumes in den westlichen
Gesellschaften. Sennett vertritt die These, dass die öffentliche Sphäre
insbesondere in den Großstädten des 20. Jahrhunderts nicht zuletzt aufgrund
eines auf Transparenz und Mobilität ausgerichteten Städtebaus entleert wird.
Wolkenkratzer, die komplett verglast sind, heben die Grenze zwischen Innen
und Außen nur scheinbar auf. Tatsächlich wird das Innere durch die Glaswände
hermetisch von der Außenwelt abgeriegelt. Die ständige Beobachtbarkeit im
öffentlichen Raum, zum Beispiel in Großraumbüros, erleichtert nicht etwa,
sondern hemmt die zwischenmenschliche Kommunikation. Sennett nennt dies „das
Paradoxon der Isolation inmitten von Sichtbarkeit“ (2008: 39). Richard
Sennett das Absterben des öffentlichen Raumes in den westlichen
Gesellschaften. Sennett vertritt die These, dass die öffentliche Sphäre
insbesondere in den Großstädten des 20. Jahrhunderts nicht zuletzt aufgrund
eines auf Transparenz und Mobilität ausgerichteten Städtebaus entleert wird.
Wolkenkratzer, die komplett verglast sind, heben die Grenze zwischen Innen
und Außen nur scheinbar auf. Tatsächlich wird das Innere durch die Glaswände
hermetisch von der Außenwelt abgeriegelt. Die ständige Beobachtbarkeit im
öffentlichen Raum, zum Beispiel in Großraumbüros, erleichtert nicht etwa,
sondern hemmt die zwischenmenschliche Kommunikation. Sennett nennt dies „das
Paradoxon der Isolation inmitten von Sichtbarkeit“ (2008: 39).
Ebenso verlieren Straßen, Promenaden und Plätze ihren Charakter als
öffentliche Räume in dem Maße, wie sie zu einem „Funktionselement von
Bewegung“, „etwas, das man durchquert, worin man sich nicht aufhält“ (2008:
40), gemacht werden. Der städtische Raum wird vor allem als Verkehrsnetz
wahrgenommen. Es gilt, möglichst viel Bewegungsfreiheit zu gewähren,
möglichst wenige Hemmnisse zu schaffen. „Der öffentliche Raum wird zu einer
Funktion der Fortbewegung“ (2008: 40). Dies verhindert soziale Interaktion,
unterminiert die Entstehung von Öffentlichkeit, und das trotz oder gerade
wegen einer zunehmenden wechselseitigen Sichtbarkeit und Beobachtbarkeit der
Individuen. Wie reagieren wir auf diese Isolation? Wir hüllen uns in
Schweigen. Wir bewegen uns durch den öffentlichen Raum wie in einer Blase.
Wir umgeben uns mit einer transparenten, aber undurchlässigen Schutzschicht,
die wir „Privatsphäre“ nennen. Das öffentliche Leben in den Großstädten – in
den Straßen und auf den Plätzen, in den Einkaufzentren und den Großraumbüros
– ist geprägt durch Schweigen und passives Beobachten. Sennett führt dieses
Phänomen auf die Psychologisierung und Personalisierung des öffentlichen
Handelns zurück. Wie sich allmählich die Vorstellung durchsetzte, das
äußerlich wahrnehmbare Handeln eines Menschen lasse unmittelbar auf sein
inneres Wesen, seine Persönlichkeit schließen („Man ist der, als der man
erscheint“), zogen sich die Menschen in die Rolle eines passiven Zuschauers
zurück, um nicht zuviel von sich selbst preiszugeben. Diese Vorstellung
beherrscht auch heute noch die Debatte über Datenschutz und
Persönlichkeitsrechte in sozialen Netzwerken. Gleichzeitig überfrachten
viele Menschen ihre persönlichen Beziehungen mit einem übersteigerten Maß an
Intimität und Selbstoffenbarung: der Seelen-Striptease als
Authentizitätstest der Persönlichkeiten und Aufnahmeprüfung für soziale
Beziehungen. Für Sennett beginnt damit die „Tyrannei der Intimität“, die den
gesellschaftlichen Umgang miteinander ins Leere laufen lässt und die
öffentliche Sphäre „privatisiert“.
Was hat es also zu bedeuten, wenn Menschen beginnen, über das Internet
inmitten des öffentlichen Raumes miteinander zu spielen? Was hat es zu
bedeuten, dass sie in Bewegung spielen? Dass es Spiele sind, die sie nicht
zum Halten zwingen, sondern die sie in Bewegung vollziehen können, ja, die
Bewegung, Fortbewegung sogar voraussetzen? Kann es nicht sein, dass diese
mobilen Spiele es den Menschen wieder gestatten, ihr voyeuristisches
Schweigen zu durchbrechen, ihre Passivität zu überwinden, sich aufeinander
einzulassen, und zwar gerade ohne den allgemeinen Zwang zur Intimität
„echter“ Freunde? Mobile Social Games tragen zu einer Entpsychologisierung
der sozialen Beziehungen im öffentlichen Raum bei, indem sie „Nähe“ nicht
mehr nur als affektive Kategorie definieren, sondern auch ihre
unpersönliche, geographische Dimension aufzeigen. Sie erlauben dem
Individuum die episodische, also die räumlich und zeitlich begrenzte
Übernahme von Rollen und damit den Aufbau von sozialen Beziehungen zu
anderen Individuen, ohne dem allgemeinen Intimitäts- und Authentizitätskult
verfallen, ohne die eigene Persönlichkeit, die inneren Gefühlsregungen und
Beweggründe offenbaren, ohne sich selbst in aller Öffentlichkeit entblößen
zu müssen. Womöglich haben Mobile Social Games damit in ihrer ganzen
Vielfalt das ungeahnte Potenzial, über neue Formen der öffentlichen
Interaktion auf einen erneuten Strukturwandel der Öffentlichkeit, nämlich
auf die Wiederentdeckung der Stadt – nicht als Farmville, sondern als Polis,
also als Raum bürgerlicher Öffentlichkeit – hinzuwirken.
„In dem Maße, wie die Menschen lernen können, ihre Interessen in der
Gesellschaft entschlossen und offensiv zu verfolgen, lernen sie auch,
öffentlich zu handeln. Die Stadt sollte eine Schule solchen Handelns sein,
das Forum, auf dem es sinnvoll wird, anderen Menschen zu begegnen, ohne dass
gleich der zwanghafte Wunsch hinzuträte, sie als Personen kennenzulernen.
Ich glaube nicht, dass dies ein müßiger Traum ist“ (Sennett 2008: 589).
Literatur
Sennett, Richard (2008): Verfall und Ende des öffentlichen Lebens.
Die Tyrannei der Intimität. Berlin Verlag. |
Die Autorin

Julia Serong
Jahrgang 1982, hat in Münster Kommunikationswissenschaft, Wirtschaftspolitik
und Englische Philologie studiert. Sie ist seit 2009 wissenschaftliche
Mitarbeiterin am
 Institut
für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Freien Universität
Berlin. Institut
für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Freien Universität
Berlin.
|