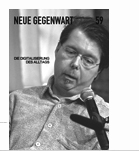|
Vor nicht allzu langer Zeit war in den Medien viel von
Leuten die Rede, die ihre intimsten Daten in Social Networks der
Weltöffentlichkeit präsentierten. Extrembeispiele ließen sich leicht
auftreiben. An den Nacktbildern von Ute M. oder den Partyfotos von Klaus D.
wurde dann allen anderen vorgeführt, wohin diese Art von Unachtsamkeit
führen kann. Man landet damit am Ende vielleicht sogar in den Massenmedien.
Die beiden zentralen Vorteile des Internets, nämlich jedem ohne
Vorkenntnisse die Veröffentlichung von Inhalten zu gestatten und zugleich
alles auf ewig speichern zu können, zeigten hier ihre unerfreuliche Seite.
Das Bewusstsein der Nutzer für die Sensibilität der veröffentlichten Daten
dürfte in den vergangenen Jahren gestiegen sein. Und auch die Anbieter von
Social Networks haben reagiert. Websites wie Facebook ermöglichen ihren
Nutzern inzwischen die genauere Kontrolle dessen, was ihre Kontakte („Freunde“)
von den eingegebenen Daten sehen dürfen. Vorausgesetzt, die Nutzer
nehmen sich die Zeit, die noch immer umfangreichen persönlichen
Einstellungen vorzunehmen.
Ist die große Offenheit schon wieder vorbei? Befinden wir uns nach der Experimentierphase
auf dem Weg zur Abschottung der eigenen Persönlichkeit
– wie sie im Alltag
normal ist?
Inzwischen sind die Social Networks mobil geworden. Sie informieren uns zum
Beispiel unterwegs, wenn Freunde und Bekannte in der Nähe sind. Und sie
können uns mitteilen, wenn jemand unseren Weg kreuzt, der unsere Interessen
teilt.
Die Bedenken, die mit der Verbreitung mobiler Social Networks verbunden
sind, liegen auf der Hand. Teilt bald wieder jeder alles mit allen
– oder
sind die Nutzer reif für die nächste Runde?
Neue Gegenwart hat mit dem Journalisten und Schriftsteller Peter Glaser über Online-Kommunikation als Wahrheits-Droge,
die Entwicklung von Offenheit und Verschlossenheit im öffentlichen Raum und über das
Vergessen im Internet gesprochen.
Herr Glaser, zeigt ihr Smartphone ihren Freunden an, wo sie sich gerade
aufhalten und welche Interessen sie haben?
Peter Glaser: Ich habe kein Smartphone. Ich schleppe mein MacBook und in der
Tasche einen Karoblock und einen Kuli mit mir herum, wenn ich unterwegs bin.
Würden sie einen solchen Dienst nutzen?
Ja, aus professionellem Interesse. Auf Dauer sehe ich aus derzeitiger Sicht
noch keinen Nutzen für mich darin, ständig virtuelle Leuchtkugeln
abzufeuern.
Wie lange wird es noch dauern, bis mobile Social
Media-Anwendungen so populär sind, dass praktisch jeder sie nutzen wird?
Social Media ist sehr jung.
 Friendster, die Mutter aller Freundschaftsnetzwerke, ist 2002 gegründet worden, das kennt heute schon
kaum noch jemand. Facebook und Twitter gibt es seit vier Jahren, die Zahlen
sind scheinbar beeindruckend. Aber das waren sie davor bei Friendster, die Mutter aller Freundschaftsnetzwerke, ist 2002 gegründet worden, das kennt heute schon
kaum noch jemand. Facebook und Twitter gibt es seit vier Jahren, die Zahlen
sind scheinbar beeindruckend. Aber das waren sie davor bei
 Second Life auch.
Kennt noch jemand Second Life? Weiß jemand, wie viele Karteileichen es auf
Facebook gibt? Wie viele passive Zuschauer? Zu dem Bedürfnis nach Prognosen
eine Anmerkung von Goethe: “Wir blicken so gern in die Zukunft, weil wir das
Ungefähre, was sich in ihr hin und her bewegt, durch stille Wünsche so gern
zu unseren Gunsten heranleiten möchten.” Social Media ist ein interessanter
Bereich, aber ich will nicht spekulieren. Second Life auch.
Kennt noch jemand Second Life? Weiß jemand, wie viele Karteileichen es auf
Facebook gibt? Wie viele passive Zuschauer? Zu dem Bedürfnis nach Prognosen
eine Anmerkung von Goethe: “Wir blicken so gern in die Zukunft, weil wir das
Ungefähre, was sich in ihr hin und her bewegt, durch stille Wünsche so gern
zu unseren Gunsten heranleiten möchten.” Social Media ist ein interessanter
Bereich, aber ich will nicht spekulieren.
Welche Hürden sind noch zu nehmen?
Ganz einfach: Alle sollten mitmachen wollen. Was wir als frühe Nutzer und
Netz-Aficionados dazu beitragen können, ist, den Laden möglichst
gastfreundlich, einleuchtend und nützlich zu gestalten, um auch das
Interesse derer zu wecken, die dem Ganzen noch fern stehen. Auch gegen
Gängelung oder Datenabzocke vorzugehen, was etwa bei Facebook immer wieder
vorkommt. Und: Alle sollten mitmachen können. Ich finde, dass sowohl die
Geräte als auch die Dienste für mobile Anwendungen noch viel zu teuer sind –
elitärer Luxus.
In
welchen Alltagssituationen wird sich die Nutzung von Mobile Social Media besonders bemerkbar machen?
Wenn man unterwegs ist, wie die Bezeichnung “Mobile” ja schon vermuten
lässt. Vor allem, wenn man beruflich unterwegs ist. Wenn die technischen
Voraussetzungen gegeben sind, wird das rasch selbstverständlich und auf
angenehme Weise banal werden. Jede neue Technologie, die sich eine Weile
blinkend und trötend in den Vordergrund drängt, muss irgendwann den langen,
mühsamen Weg durch die Ebene antreten. Ich glaube, dass wir uns alle ein
bisschen in Autos verwandeln werden. Wie zuvor Fahrzeuge, werden wir uns
künftig auch als Fußgänger viel eingehender von Winken aus der Onlinewelt
navigieren lassen.
Rollen werden überall gespielt – natürlich auch in Social Networks wie
Facebook. Wird die Bühne durch die Übertragung alltäglicher Informationen an
andere über mobile Geräte nicht immer größer – und der Backstagebereich am
Ende zu klein, um noch man selbst sein zu können?
Es hängt von einem selbst ab, wie groß oder wie intensiv bespielt diese
Bühne ist. Plötzlich eine kleine Internet-Sendestation sein zu können und
nicht nur, wie am Fernseher laut/leise und hell/dunkel einstellen zu können
und sich berieseln zu lassen, macht schon ziemlich Spaß, ist aber auch viel
Arbeit. Und das Kommunikationsuniversum bietet auch jede Menge eskapistische
Möglichkeiten. Man sollte natürlich den Nahbereich, in dem man als
gerätelose, pure Person existiert, nicht aus dem Blick verlieren. Nahsehen
ist das unterschätzteste Nichtmedium des 21. Jahrhunderts – um es mal
paradox auszudrücken.
Wird mit der steigenden Transparenz von Alltagshandlungen
verantwortungsvolles und gesellschaftlich akzeptiertes Handeln in der
Gesellschaft wichtiger – und ist die Motivation dafür nicht problematisch,
nach dem Motto: wenn du nicht immer edel, hilfreich und gut bist, droht der
Internetpranger?
Nein, das funktioniert eher nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren. Am
Beispiel der Telefonzellen kann man gut sehen, wie sich Transparenz in der
Öffentlichkeit entwickelt hat. Vor 30 Jahren war eine Telefonzelle ein
richtiges kleines Häuschen, dann gab es irgendwann Schwingtüren, dann
reduzierten sich die Wände auf kleine Schallschutzwangen in Kopfhöhe, danach
gab es dann nur noch diese unbehausten Telefonmarterpfähle am Gehweg – da
ist die Entwicklung übrigens wieder rückläufig, das heißt, die bekommen
jetzt zum Teil wieder kleine Dächer und Seitenwände, ob als
Intimitätsminimum oder damit einem der Regen nicht ins Gesicht weht, sei
dahingestellt. Jedenfalls kann man sich parallel zur Transparenzierung der
Telefonzelle beispielsweise ansehen, wie sich Autoinnenräume in dem selben
Zeitraum immer mehr abgeschattet und abgedunkelt haben. Ich bin davon
überzeugt, dass es so etwas wie einen Grundbestand an Intimität,
Schamhaftigkeit, Geheimnis – wie immer man das nennen will, gibt. Wenn es an
einer Stelle hell und durchsichtig wird, sollten wir auch sorgfältig
beobachten, wo sich die Dinge auf neue Weise verstecken.
Wie viel Ehrlichkeit ist in Social Media-Anwendungen möglich? Werden wir
Opfer des Eindrucks, den wir machen wollen?
Online-Kommunikation wirkt auf viele Menschen wie eine Wahrheitsdroge. Es
ist erstaunlich, in wie kurzer Zeit sich Onlinebekanntschaften oft
höchstpersönliche Dinge mitteilen, die bei herkömmlichen Bekanntschaften
oder Freundschaften erst einen ziemlichen Vertrauensunterbau benötigen. Das
ist eine der interessanten Folgen von Pseudonymität, Anonymität und
Virtualität im Netz. Man ist online sozusagen als eine reserviertere Form
von Persönlichkeit vorhanden. Im Gegenzug kann man sich, zumindest
probeweise, gefahrloser öffnen als einem auch körperlich anwesenden Menschen
gegenüber. Natürlich gab es diese Virtualisierung zum Teil auch schon beim
althergebrachten Briefeschreiben oder beim Telefonieren.
Stichwort Mobile Social Games: Unternehmen arbeiten an Spielen, die überall
unterwegs mit Freunden und auch mit Fremden gespielt werden können. Wie
sieht die Zukunft dieser Entwicklung ihrer Meinung nach aus?
Wenn ich mir
 Zynga-Spiele wie Farmville oder Mafia Wars auf Facebook ansehe,
würde ich sagen, dass da an digitalen Formen von Drogensubstitution
gearbeitet wird. Legale Drogen, die auch bereits Kollateralschäden wie beim
Passivrauchen zeigen, etwa wenn einem die Timeline vollgequalmt wird mit den
neuesten Ernteerfolgen von frisch angejunkten Farmwillis. Zynga-Spiele wie Farmville oder Mafia Wars auf Facebook ansehe,
würde ich sagen, dass da an digitalen Formen von Drogensubstitution
gearbeitet wird. Legale Drogen, die auch bereits Kollateralschäden wie beim
Passivrauchen zeigen, etwa wenn einem die Timeline vollgequalmt wird mit den
neuesten Ernteerfolgen von frisch angejunkten Farmwillis.
Was für ein Spiel wünschen sie sich?
Ich würde mir eine Art Nicht-Spiel wünschen. Ein Spiel, bei dem man sich
nicht durch feindliche Umgebungen bewegt oder ständig irgendwelche Prüfungen
ablegen muss, sondern bei dem ich mich durch Stimmungen hindurchspielen
kann. Durch Dinge, die meine Inspiration herausfordern. Das Spiel gibt es im
übrigen schon, heißt Internet.
Die Gesellschaft ist stets bestrebt, möglichst viele Informationen dauerhaft
zu speichern – für das Individuum dagegen ist Vergessen lebenswichtig. Wie
könnte das Vergessen als Funktion des Internets eingebaut werden?
Man kann Dateien oder Postings zum Beispiel eine Halbwertszeit geben. Das
könnte man auch farblich anschaulich machen – Icons, die wie Laub verwelken,
von grün bis braun, oder die verblassen, bis nichts mehr zu lesen ist.
Kann
eine solche Vergessen-Funktion umgesetzt werden? Oder nur für die Nutzer,
während die Unternehmen weiterhin alles protokollieren?
Wenn wir unser Selbstbild als Menschen im Netz wiederfinden wollen, wird es
für die Maschinen unvermeidlich sein, das Vergessen zu lernen. Für einen
Technokraten ist ein Löschvorgang ein Mangel, eine ungenutzte Möglichkeit.
Für einen Menschen ist das Vergessen aber kein Mangel, sondern ein wichtiger
Teil dessen, was einen Menschen zum Menschen macht. Dinge wie
Resozialisierung oder das, was die christliche Ethik Vergebung nennt, sind
edle Formen des Vergessens. Wenn man einem Menschen nachsagt, er habe ein
Elefantengedächtnis, verheißt das nichts Gutes, sondern dass er nachtragend
ist. Und dann wird es einem auch unnötig schwer gemacht, sich zu verändern,
wenn man ständig darauf festgelegt wird, was man früher mal getan und
gedacht hat. Das Internet und der grassierende Speicherwahn bilden derzeit
eine Maschine, die automatisch ein extreme Form von Konservativismus
produziert.
Wo
würden sie sich entsprechende Vergessens-Funktionen wünschen?
“I can’t forget, but I don’t remember what” (Leonard Cohen).
Für sehr viele alltägliche Anwendungen gibt es inzwischen Programme auf
Smartphones.
Welche App wünschen sie sich, die es noch nicht gibt?
Eine, der ich sagen kann, was ich möchte und sie macht’s.
Wofür wird es nie eine App geben?
Für uns, Bruder. Und für die Ängste von Frank Schirrmacher. |
Zur Person
Peter Glaser
Geboren 1957 in Graz. Schriftsteller, Journalist und Ehrenmitglied des
 Chaos Computer Clubs. 1986 bis 1996 erschien seine Kolumne
„Glasers heile
Welt“
in der Zeitschrift Tempo, 2002 erhielt er für seine
„Geschichte von
Nichts“
den Ingeborg-Bachmann-Preis. Er schreibt u. a. regelmäßig in seinem
Blog Chaos Computer Clubs. 1986 bis 1996 erschien seine Kolumne
„Glasers heile
Welt“
in der Zeitschrift Tempo, 2002 erhielt er für seine
„Geschichte von
Nichts“
den Ingeborg-Bachmann-Preis. Er schreibt u. a. regelmäßig in seinem
Blog
 Glaserei
bei der Stuttgarter Zeitung und in Glaserei
bei der Stuttgarter Zeitung und in
 Technology
Review. Peter Glaser auf Twitter:
@peterglaser. Technology
Review. Peter Glaser auf Twitter:
@peterglaser.

Verwandte Themen
"Datenschutz ist ungeil"
Interview mit Peter Glaser (2007)
|